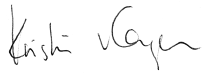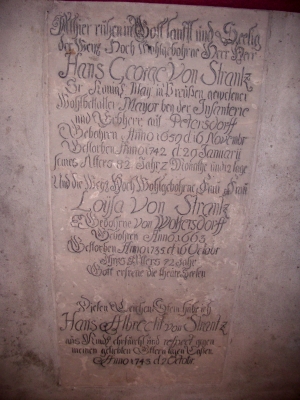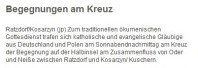Liebe Leserin, lieber Leser,
So steht es im Psalm 42. Und dieser Vers ist uns als Monatsspruch für den September in die Hand gegeben. Da kommt mir spontan eine Liedstrophe in den Sinn. Eine Liedstrophe aus dem Kindergesangbuch nämlich: „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht’s schief. Wir sind die Hefe im Teig der Gemeinde. Egal was andre sagen, wir machen mit.“
Das Lied schwirrt mir vor allem deshalb so präsent durch den Kopf, weil wir es gern und oft in der Christenlehre schmettern. Aber was hat das nun mit unserem Monatsspruch zu tun?
Ja, es ist weit hergeholt, aber der Gedanke ist trotzdem da: Ließe sich die Stärke Gottes mit der Speisestärke vergleichen, die unsere Kuchen besonders geschmeidig und wertvoll macht? So wie wir unsere Christenlehrekinder mit der unterstützenden
Kraft der Hefe im Kuchenteig vergleichen? Wohl kaum. Aber was genau bedeutet dann der Begriff „Stärke“? Dieser Begriff, der in der Bibel in der Luther Übersetzung mindestens 50-mal mit Gott in Verbindung gebracht wird. Zunächst einmal denken wir dabei sicher an die körperliche Kraft – den starken Mann, den nichts umwerfen kann. Aber Stärke bedeutet nicht nur körperliche Kraft, sondern noch sehr viel mehr. Stärke ist auch ein Ausdruck für Macht. Stellt man sich gegen etwas oder kämpft mit allen Mitteln für eine Sache, so zeigt man Stärke. Stärke kann die Stärke einer Konzentration messen – die Stärke des Kaffees z. B. Oder sie sagt aus, was jemand besonders gut kann, worin er sich hervortut – was eben seine Stärke ist. Gott ist unsere Stärke.
Wenn ich mir diese Bedeutungen auf der Zunge zergehen lasse, erfasst mich Mut.
Denn dieser Satz sagt mir: wenn ich Gott an meiner Seite weiß, wenn ich
mich ganz hinter diesen Satz stelle, dann kann ich allen Herausforderungen des
Lebens gelassen entgegengehen. Denn ich muss diese Herausforderungen nicht
nur aus eigener Kraft bewältigen. Nein, ich habe darüber hinaus Zugang zu einer
anderen, unerschöpflichen Kraftquelle.
Zu einer Macht, zu einer Essenz höchster Konzentration, die für mich da ist. Für mich und für dich!
Und das schenkt mir Zuversicht. Gerade in Zeiten, in denen Althergebrachtes auf
wackligen Beinen zu stehen scheint. Nein – wir müssen uns nur immer wieder
darauf besinnen:
Gott ist unsere Stärke und Zuversicht.
Und dann stellt sich vielleicht Gelassenheit ein, Vertrauen und Freude.
Die Freude, die ich im Zusammensein mit unseren Christenlehrekindern empfinde. Sie machen mich zuversichtlich. Und noch ein Lied kommt mir in den Sinn und harmonisiert
wunderbar mit dem Lied aus dem Kindergesangbuch. Im Lied aus Taizé heißt es: „Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht!“
Ihre Diakonin Kristin von Campenhausen